Article contents
Die Antijüdische Polemik Im Johannesevangelium1
Published online by Cambridge University Press: 05 February 2009
Abstract
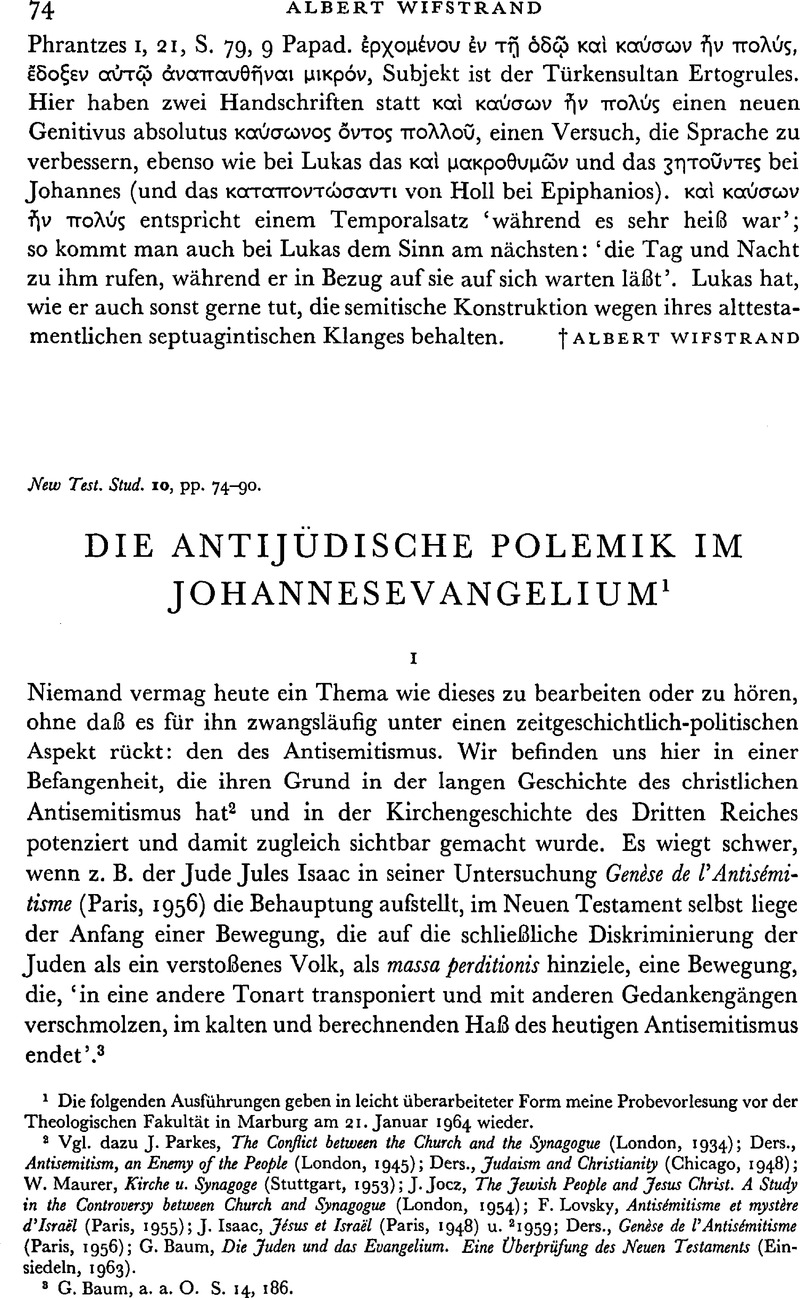
- Type
- Short Studies
- Information
- Copyright
- Copyright © Cambridge University Press 1964
References
page 74 note 2 Vgl. Parkes, dazu J., The Conflict between the Church and the Synagogue (London, 1934)Google Scholar; Ders., Antisemitism, an Enemy of the People (London, 1945)Google Scholar; Ders., Judaism and Christianity (Chicago, 1948)Google Scholar; Maurer, W., Kirche u. Synagoge (Stuttgart, 1953)Google Scholar; Jocz, J., The Jewish People and Jesus Christ. A Study in the Controversy between Church and Synagogue (London, 1954)Google Scholar; Lovsky, F., Antisémitisme et mystére d'Israël (Paris, 1955)Google Scholar; Isaac, J., Jésus et Israël (Paris, 1948)Google ScholarU. 2 1959Google Scholar; Ders., Genèse de l'Antisémitisme (Paris, 1956)Google Scholar; Baum, G., Die juden und das Evangelium. Eine Überprüfung des Neuen Testaments (Einsiedeln, 1963).Google Scholar
page 74 note 3 Baum, G., a. a. O. S. 14, 186.Google Scholar
page 75 note 1 Jocz, Siehe die bei J., ‘Die Juden im Johannesevangelium’, Judaica, IX (1953), 129 ffGoogle Scholar. und Baum, G. a. a. O. S. 14 ff.Google Scholar, 27 Genannten.
page 75 note 2 a. a. O. S. 146.Google Scholar
page 75 note 3 Chrysostomus, , Adversus Judaeos, I, 5Google Scholar (M.P.G. XLVIII, hier besonders die erste und sechste der insgesamt acht Predigten gegen die Juden, bes. Sp. 847 f. und 852).
page 75 note 4 Das vierte Evangelium in seiner ursprünglichen Gestalt verdeutscht und erklärt (Tübingen, 1936).Google Scholar
page 75 note 5 John Defends the Gospel (Chicago, 1936), S. 150Google Scholar: ‘The first readers of the Fourth Gospel were… an anti-Semitic group, patriotic citizens of the Roman Empire.’
page 75 note 6 Jesus der Galiläer und das Judentum (Leipzig, 1940), S. 224 ff.Google Scholar
page 75 note 7 Windisch, H., ‘Das johanneische Christentum u. sein Verhältnis zum Judentum und zu Paulus’, Chr. Welt. XLVII (1933), 98–107, bes. S. 99.Google Scholar
page 75 note 8 Einen klaren Protest gegen den Mißbrauch des Joh.-Ev. bedeutete der Aufsatz von Sikes, W. W., ‘The Anti-Semitism of the Fourth Gospel’, J.R. XXI (1941), 23 ff.Google Scholar
page 75 note 9 a. a. O. S. 232.Google Scholar
page 76 note 1 N.T.D. IV (9 1959) S. IIGoogle Scholar. Daß Joh. auf der antijüdischen Woge seiner Zeit geschwommen sei, ist u. a. die Bauer, Meinung von W., Exk. z. i. 19Google Scholar; E. C. Colwell, a. a. O. and Schrage, W., Th. W. VII, 849 f.Google Scholar – Vgl. dagegen jedoch Sikes, W. W., a. a. O. S. 24Google Scholar, Oepke, U. A., a. a. O. S. 239.Google Scholarunten, Siehe dazu S. 86 f.Google Scholar
page 76 note 2 Die Synoptiker gebrauchen den Ausdruck nur selten, jedoch niemals ‘als eigentliche Bezeichnung des Volker, mit dem Jesus es zu tun hat’ (Gutbrod, W., Th. W. III, 376).Google Scholar Vgl. Jocz, J., Judaica, IX (1953), 1390Google Scholar
page 76 note 3 Zur Sache vgl. Lütgert, W., Die Juden im Joh.-Ev., Festschr. f. G. Heinrici (1914), S. 147 ff.Google Scholar; Bauer, W., Exk. z. i. 19Google Scholar; Gutbrod, W., Th. W. III, 378, 26 ff.Google Scholar; Jocz, J., a. a. O. S. 139 ff.Google Scholar; Baum, G., a. a. O. S. 150 ff.Google Scholar
page 76 note 4 Gutbrod, Mit W., Th. W. III, 378, 29 f.Google Scholar; Jocz, J., a. a. O. S. 139 f.Google Scholar; Robinson, J. A. T., ‘The Destination and Purpose of St John's Gospel’, N.T.S. vi (1959/60), 125Google Scholar gegen Schlatter, A., Die Sprache und Heimat des vierten Evangelisten (Gütersloh, 1902), S. 44Google Scholar und Bultmann, R., Das Evgl. d. Joh. (Meyer11 1950), S. 59.Google Scholar
page 77 note 1 a. a. O. S. 59.
page 77 note 2 So richtig Lee, E. K., The Religious Thought of St John (London, 1950), S. 121 ffGoogle Scholar. Vgl. auch Oepke, A. a. a. O. S. 238Google Scholar und Hoskyns, E. C.-Davey, F. N., The Fourth Gospel (London, 1947), S. 356.Google Scholar
page 77 note 3 Das Evangelium Johanna (Berlin, 1908).Google Scholar
page 77 note 4 ‘Das Johannes-Evangelium’, in Die Schriften des Neuen Testaments, II (2 1908), S. 688.Google Scholar
page 77 note 5 Das Johannesevangelium. Studien zur Kritik seiner Erforschung (Tübingen, 1911), S. 394.Google Scholar
page 77 note 6 Stauffer, E., ‘Probleme der Priestertradition’, Th.L.Z. LXXXI (1956), 146 u. Anm. 64.Google Scholar
page 77 note 7 So. Baum, G., a. a. O. S. 151.Google Scholar
page 77 note 8 Vgl. dazu Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 59, 209, Anm. 8.Google Scholar
page 77 note 9 Baum, G., a. a. O. S. 153.Google Scholar
page 77 note 10 Joh. differenziert nicht mehr wie die Synoptiker das jüdische Volk in Arme, Reiche, Dirnen, Sünder, Gerechte, Sadduzäer, Herodianer, Zeloten, Zöllner and Schriftgelehrte. Dies markiert deutlich seinen fortgeschrittenen kirchlichen Standpunkt, von dem aus er auf die Jesuszeit zurückblickt. Diese zeitliche Distanz umgreift zugleich eine sachliche Distanzierung, wenn er von den judischen Bräuchen als von etwas Fremdem redet (ii. 6, 13; v. 1; vi. 4; vii. 2; X. 40), vor allem, wenn er Jesus vom jüdischen Gesetz Distanz nehmen läßt (viii. 17; X. 34 u. ö.).
page 78 note 1 Schnackenburg, R., ‘Logos-Hymnus und johanneischer Prolog’, B.Z. N.F. I (1957), 69–109.Google Scholar Vgl. auch Bultmann, R., Joh.-Kom. S. I ff.Google Scholar
page 78 note 2 So Baldensperger, W., Der Prolog des vierten Evangeliums. Sein polemisch-apologetischer Zweck (Freiburg i. Br., 1898).Google Scholar
page 78 note 3 ‘Aufbau und Anliegen des johanneischen Prologs’, in Libertas Christiana, Festschr. für F. Delekat (1957), S. 75–99.Google Scholar
page 78 note 4 ‘Probleme des johanneischen “Prologs”’, Z.Th.K. Lx (1963), 305–34.Google Scholar
page 78 note 5 Vgl. Hoskyns-Davey, , a. a. O. S. 152Google Scholar; Bernard, J. H., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St John (I.C.C.), I (Edinburgh, 4 1953), S. 30.Google Scholar
page 78 note 6 So Heitmüller, z. B. W., a. a. O. S. 695, 725Google Scholar. – Ähnlich folgert auch Boismard, M.-E., Le Prologue de Saint Jean (Lectio divina II) (Paris, 1953), S. 166Google Scholar, Joh, daß. i. 14–18Google Scholar in der urchristlichen Tradition des Vergleiches der beiden Bund-Mittler (Mose und Christus) steht, wie sie z. B. I. Kor. x. 1–6 and Hebr. iii. I ff. vorliege. Ähnlich auch R. Schnackenburg, L.Th.K. 2 v, 1002. – Daß Job. das Verhältnis von Gesetz und Gnade als ein solches von ‘Schatten’ und ‘Wirklichkeit’ sieht wie Hebr. x. I und Kol. ii. 17 (so Macgregor, G. H. C., The Gospel of John ‘The Moffatt N.T.’ (London, 11 1953), S. 21Google Scholar), oder daß er den Nomos als praeparatio evangelica versteht (Lightfoot, R. H., St John's Gospel [Oxford, 1956], S. 86Google Scholar), ist sicher unzutreffend. Richtig A. Wikenhauser z. St.: ‘Da die beiden Vershälften in scharfer Antithese zueinander stehen, wird nur der Gegensatz zwischen Altem und Neuem ins Auge gefaßt’ (‘Das Evangelium nach Joh.’, R.N.T. IV [3 1961]).Google Scholar
page 79 note 1 Haenchen, E., a. a. O. S. 311Google Scholar, Anm. 36. Vgl. auch Ders., ‘Aus der Literatur zum Johannesevangelium 1929–1956’, Th.R. XXIII (1955), 326Google Scholar, wo er dem Versuch von E. Hirsch, Joh. ganz vom Gegensatz Gesetz/Gnade her auszulegen, entgegentritt mit dem richtigen Argument, daß die Freiheit vom Gesetz ‘fur Johannes nicht mehr aktuell’ war.
page 79 note 2 Vgl. Wrede, W., ‘Charakter und Tendenz des Johannesevangeliums’, S.G.V. XXXVII (1903 = 2 1933), 42Google Scholar. – Windisch, H., a. a. O. S. 107Google Scholar, findet ‘Anerkennung und Beiseiteschiebung’ der at'l. Religion zugleich. Bornhäuser, Ähnlich K., ‘Das Johannesevangelium eine Missionsschrift für Israel’, B.F.chr.Th. II, 15 (1928), 13 f.Google Scholar; Schlatter, A., Der Evangelist Johannes (Stuttgart, 1930), S. 33Google Scholar. – i. 17 gilt oft auch als dictum probans dafür, daß der ganze Prolog antithetisch gegen die Tora gezielt ist, vgl. Strathmann, , S. 12Google Scholar; Oepke, , S. 234Google Scholar; Molin, G., Die Söhne des Lichtes (Wien/München, 1954), S. 237Google Scholar, Anm. 76 U. 82 a.
page 79 note 3 Vgl. Bultmann, R., Joh.-Kom., S. 53Google Scholar; Wellhausen, J., S. IIIGoogle Scholar; Wikenhauser, A., a. a. O. S. 50.Google Scholar
page 79 note 4 Vgl. Barrett, C. K., The Gospel according to St John (London, 2 1956), S. 141Google Scholar. – Boismard, Nach M.-E., a. a. O. S. 170Google Scholar, Soll i. 17 zeigen, ‘que le Christ est le nouveau Moïse de l'alliance nouvelle’. Auf gar keinen Fall! Denn sofern Mose der Repräsentant der Tora ist, erscheint Christus als sein Antityp (s. oben)! Überhaupt bleibt zu bedenken, daß die heilsgeschichtliche Abfolge vom Alten zum Neuen Bund kein Thema des vierten Evangelisten ist (vgl. Bultmann, R., Theologie des N. T. [Tübingen, 4 1961], S. 360Google Scholar), ja, daß er überhaupt nicht heilsgeschichtlich denkt. Vgl. dazu besonders Schweizer, Eduard, ‘Der Kirchenbegriff im Evangelium und den Briefen des Johannes’, in Stud. Evangelica, T.U. LXXIII (v. 18) (Berlin, 1959), S. 363–83Google Scholar (= Neotestamentica [ Zürich, , 1963], S. 254–71Google Scholar, bes. S. 260 f.).
page 79 note 5 Vgl. Hoskyns-Davey, , a. a. O. S. 152.Google Scholar
page 80 note 1 Es bedeutet eine unerlaubte Abschwächung dieses scharfen Gegensatzes, wenn G. Baum sagt, der johanneische Jesus habe nur unteischeiden wollen ‘zwischen dem, wie er selbst sich die Tora zueigen gemacht hatte und sie erfüllte, und wie die Führer sie überhaupt nicht verstanden’ (a. a. O. S. 170). Bultmann, Richtig R., Joh: Kom. S. 59Google ScholarU. Ergh. 2, S. 16Google Scholar; Feine-Behm-Kümmel, , Einl. in das N.T. (Heidelberg, 13 1964), S. 159.Google Scholar
page 80 note 2 Das sieht zunächst doch wie eine rabbinische Disputation über Fragen des Gesetzes aus. Doch ein Vergleich mit Mk. ii. 23–iii. 6 zeigt sofort den Unterschied: bei Mk. die Frage, wieweit das Sabbathgebot für den Menschen Gültigkeit hat; bei Joh. allein Demonstration der Vollmacht Jesu als des Gottessohnes (vgl. Bultmann, R., Theol. S. 356Google Scholar).
page 81 note 1 Joh. ii. 45 f.! – W. Heitmüller war der Meinung, daß Joh. diesen Vorwurf (Winkelprophet!) damit zu entkräften suchte, daß er Jesum am meisten in Jerusalem und an den großen jüdischen Festen auftreten ließ, a. a. O. S. 705. Eine überzeugende Erklärung! Erwägenswert ist auch die Erklärung von T. C. Smith, Jesus in the Gospel of John (Nashville, 1959), S. 144 ff., bes. S. 182: Joh. benütze die betonte Herausstellung der jüdischen Feste als ‘Kontext’, um den Juden zu zeigen, daß Jesus die Erfüllung aller göttlichen Verheißung sei.
page 81 note 2 Zur Sache vgl. bes. Wrede, W. a. a. O. S. 43 ff.Google Scholar, der alle Streitpunkte unter diesem Gesichtspunkt zusammengestellt hat.
page 81 note 3 Vgl. dazu Caroll, K. L., ‘The Fourth Gospel and the Exclusion of Christians from the Synagogues’, in Bulletin of the John Rylands Library, XL., 1 (1957/8), 19–32CrossRefGoogle Scholar; W. Schrage, Art. άποσυνάγωγος, Th. W. VII, 845 ff.Google Scholar
page 81 note 4 Schlier, H., ‘Jesus und Pilatus nach dem Johannesevangelium’, Beiträge z. Ev. Theol. I (1940), 28 ffGoogle Scholar. (=Die Zeit der Kirche [1956], S. 56–74Google Scholar; bes. S. 58). Vgl. Haenchen, auch E., ‘Jesus vor Pilatus’, Th.L.Z. LXXXV (1960), 93–102Google Scholar, bes. S. 95 f.
page 82 note 1 Das gilt unbeschadet der Tatsache, deß der νόμος in xix. 7 nicht allgemein die Tora meint, sondern das Einzelstatut, also speziell den Kasus der Gotteslästerung (Barrett, S. 451); denn so oder so deklarieren die Juden damit Jesu Tod als Erfüllung des Gesetzes, xi. 50, 51 (vgl. Hoskyns-Davey, , S. 523Google Scholar; bes. Windisch, H., Christl. Welt, XLVII [1933], 104 f.Google Scholar).
page 82 note 2 Wellhausen, J., S. III; vgl. S. 121 ffGoogle Scholar.
page 82 note 3 Wellhausen, J., S. 122.Google Scholar
page 82 note 4 Wrede, W. S. 25.Google Scholar
page 82 note 5 Vgl. Bultmann, R., Theol. S. 356.Google Scholar
page 83 note 1 Bultmann, R., Theol. S. 380.Google Scholar
page 83 note 2 Käsemann, E., ‘Besprechung von R. Bultmann, Joh.-Kom.’, V.F. (1942/1946), (1946/7), S. 189Google Scholar. Vgl. auch schon Wrede, W., S. 19.Google ScholarHeitmüller, Ferner W., S. 688Google Scholar; Windisch, H., ‘Die Absolutheit des Johannesevangeliums’, Z.sys.Th. v (1927), 3–54Google Scholar, bes. 41.
page 83 note 3 Es ist eine öfter vertretene Meinung, die Polemik Jesu richte sich ausschließich gegen das gesetzesstrenge Judentum (Lütgert, z. B. W., a. a. O. S. 147 ff.Google Scholar; Bornhäuser, K. a. a. O. S. 19 ff.Google Scholar; Sikes, W. W., a. a. O. S. 24 f.Google Scholar) bzw. dessen ‘öffentliche Vertreter’ (Baum, G., a. a. O. S. 164Google Scholar). Vgl. dagegen jedoch Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 59Google Scholar, Anm. 7.
page 83 note 4 Goppelt, L., ‘Christentum und Judentum im ersten u. zweiten Jahrhundert’, B.F.chr.Th. 11, 55 (1954), 252.Google Scholar
page 83 note 5 Haenchen, E., ‘Judentum u. Christentum in der Apostelgeschichte’, Z.N.W. LIV (1963), 155Google Scholar. – Vgl. auch Oepke, A., a. a. O. S. 235.Google Scholar
page 83 note 6 Vgl. Heitmüller, W., S. 692Google Scholar; Wrede, W., S. 40 ff.Google Scholar, bes. Schlier, H., a. a. O. S. 56 ff.Google Scholar
page 83 note 7 Vgl. dazu Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 432 ff.Google Scholar; Barrett, , S. 405 ff.Google Scholar
page 83 note 8 Käsemann, E., a. a. O. S. 189Google Scholar: ‘Die “Historie” ist in unserm Evangelium bloß noch Reflex theologischer Abstraktion, das vorweggenommene Echo der Verkündigung.’ – Das trifft auf die Polemik genau zu!
page 84 note 1 Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 159Google Scholar. Vgl. auch Oepke, A., a. a. O. S. 232.Google Scholar
page 84 note 2 Beilner, W., Christus und die Pharisäer. Exegetische Untersuchung über Grand und Verlauf der Auseinandersetzungen (Wien, 1959), S. 159.Google Scholar
page 84 note 3 Vgl. Kern, dazu W., ‘Der symmetrische Gesamtaufbau von Jo. viii. 12–58’, Z.K.Th. (1956), S. 451–4Google Scholar; Dodd, C. H., ‘A l'arriére-plan d'un dialogue johannique (Jo. viii. 33–58)’, R.H.P.R. (1957), S. 5–17.Google Scholar
page 84 note 4 Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 211.Google Scholar
page 84 note 5 Ebd. S. 213. – Bultmann weist mit Recht darauf hin, daß die Ortsangabe (‘Diese Worte redete Jesus, als er beim Opferstock im Tempel lehrte’, V. 20) der Szene ihre Bedeutung gibt: Im Tempel fällt Jesus das Urteil, daß die Juden nichts von Gott wissen; ‘im Tempel selbst haben sie ihre Verschlossenheit für den Offenbarer dokumentiert! Damit ist das Urteil über die jüdische Religion gesprochen…’ (ebd.).
page 84 note 6 Vgl. Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 265Google Scholar; Hoskyns-Davey, , S. 334Google Scholar; Wikenhauser, A., S. 172 f.Google Scholar
page 85 note 1 Windisch, H., Christl. Welt, XLVII (1933), 104.Google Scholar
page 85 note 2 Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 222.Google Scholar
page 85 note 3 Vgl. dazu Bauer, W., S. 29Google Scholar; bes. Bligh, J., ‘The Church and Israel according to St John and St Paul’, in Studiorum Paul. Congr., Analecta Biblica, XVII–XVIII, I (1963), 151–6.Google Scholar
page 86 note 1 Strathmann, H., N.T.D. IV (9 1959), S. 152Google Scholar. – W. Heitmüller schrieb einst über den johanneischen Jesus: ‘der konnte nicht über Jerusalem weinen; er gleicht nicht der Henne, die nicht mäde wird, ihre Brut zu locken – denn das Volk erscheint bereits am Anfang seiner Wirksamkeit (ii. 24 ff.) als hoffnungslos verstockt und verloren’ (S. 688).
page 86 note 2 In der ältesten palästinischen Fassung lautet die 12. Benediktion des Schemone Esre: ‘Die Nazarener (![]() =Christen) und die Häretiker (
=Christen) und die Häretiker (![]() ) mögen zugrunde gehen in einem Augenblick, ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden’ (Str.-B. IV, 212 f.). Zur Sache und Lit. vgl. Schrage, W., Th. W. VII, 847 ff.Google Scholar
) mögen zugrunde gehen in einem Augenblick, ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden’ (Str.-B. IV, 212 f.). Zur Sache und Lit. vgl. Schrage, W., Th. W. VII, 847 ff.Google Scholar
page 86 note 3 In unserm vierten Evgl. weist das nur hier vorkommende άποσυνάγωγος (ix. 22; xii. 42; Xvi. 2) deutlich auf diesen geschichtlichen Vorgang gehen Ende des I. Jahrhunderts hin. Die vieldiskutierte Frage, welcher sachliche Vorgang durch das άποσυνάγωγος angezeigt ist, wird man wohl mit W. Schrage dahingehend zu beantworten haben, daß nicht an die jüdische Bannpraxis gedacht ist, ‘sondern an die Verfluchung der Häretiker (Birkath ha-Minim); denn erst hier handelt es sich um radikale Scheidung, ja Feindschaft’ (Th.W. VII, 847, g ff.Google Scholar). Wie aus dem anfänglichen friedlichen Nebeneinander von Kirche und Synagoge das feindliche Gegeneinander werden konnte, ist nicht mehr klar zu erkennen. Wahrscheinlich spielt hier die durch die Tempelzerstörung im Jahre 70 eingeleitete Entwicklung eine Rolle. Sicher ist, daß der Bruch dann sehr schnell zu einer unversöhnlichen Feindschaft wurde. Neben der Birkath ha-Minim gibt es dafür eine Reihe altkirchlicher Zeugnisse. Justin spricht zuerst davon, daß die Synagogen Stätten sind, an denen die Juden die Christen verfluchen: Dial. xvi, 4 καταρώμενοı έν ταίς συναγωγαί ς υμων τους πıστευοντας έπι τόν χρıστόν. Vgl. Dial. xcvi, 2; cxxxvii, 2; Epiph. Haer. xxix, 9, 2; Hier. Comm. in Is. II, 81 zu v. 19 (M.P.L. xxiv, 86 A) u. ö. Origenes weiß zu berichten, daß Jesus in den Synagogen geästert wird (G.C.S. Orig. III, 168). Darum sind sie auch für Hieronymus synagogae satanae (C.S.E.L. LIX, 228), für Tertullian die fontes persecutionum (C.Ch. 11, 1089), für Chrysostomus die ‘Rauberhöhlen’, ja das δαıμόνων καταγώγıον (M.P.G. XLVIII, 848 f.); ένθα δέ πόρνη έστηκεν, πορνείον έστıν ό τόπος … σπήλαıον ληστων, και καταγώγıον θηριων (ebd. 847; vgl. auch, Coast. Ap. 11, 61, 1–2Google Scholar). Die jüdische Synagoge ist die συναγωγή χρıστοκτόνων (Coast. Ap. 11, 61, 1), vor deren Besuch die Christen dringend gewarnt werden (Coast. Ap. II, 61, i f.; VIII, 47, 65.71; Chrys. M.P.G. XLVIII, 850). Umgekehrt waren die Rabbinen nicht minder feindselig eingestellt (vgl. das Material bei Str.-B. Iv, 218 f., 331; I, 406 f.). Eine sorgfältig beobachtete Verfluchung der Nazarener als ‘integrierender Teil des Synagogengottesdienstes und des täglichen Gebetes jedes Juden’ (Schrage, , Th. W. VII, 848, 12 f.Google Scholar) machte natürlich einen weiteren Besuch der Christen in den Synagogen unmöglich. ‘Das Bekenntnis zu Jesus Christus bedeutete in Zukunft eo ipso Exkommunikation und Ausschluß aus dem Judentum. In diese Zeit gehören auch die joh. Aussagen’ (Schrage, ebd. 848, 15 ff.). Vgl. Smith, auch T. C., a. a. O. S. 32 ff.Google Scholar; Jocz, J., a. a. O. S. 140 f.Google Scholar; Caroll, K. L., a. a. O. S. 19 ff.Google Scholar; Goppelt, L., a. a. O. S. 154 f.Google Scholar; Feine-Behm-Kummel, , Einl. S. 159Google Scholar; Baum, G., a. a. O. S. 15 ff. (Lit.!).Google Scholar
page 87 note 1 Strachan, R. H., The Fourth Gospel. Its Significance and Environment (London, 3 1945)Google Scholar, stellt die bei Joh. und Justin z. T. parallele Thematik zusammen: Jesu dunkle Herkunft (Dial. viii; vgl. Joh. vii. 27), sein Geburtsort, (Dial. cviii; vgl. Joh. vii. 41 f.)Google Scholar, Sabbathobservanz, (Dial. xxiii, xxvi f.Google Scholar, xlvii; vgl. Joh. ix. 17 f.; vii. 19 f.), Elia, das Kommen des (Dial. xlix f.; vgl. Job. i. 21)Google Scholar, Samariter, Juden u. (Dial. Lxxviii; vgl. Joh. iv. i ff.; viii. 48Google Scholar) (S. 51). Vgl. auch Lee, E. K., The Religious Thought of St John (London, 1950), S. 122.Google Scholar
page 87 note 2 Vgl. Schnackenburg, R., B.Z. N.F. 1 (1957), 109Google Scholar: ‘Die Grundtendenz der johanneischen Darstellung ist innerchrisdich….’
page 87 note 3 Die Zusammengehörigkeit von apologetischem u. polemischen Zweck hatte schon W. Baldensperger klar erkannt: wo falsche Ansprüche zurückgewiesen werden, wird zugleich der in den Schatten gestellte Christus wieder ans Licht gezogen (a. a. O. S. 56).
page 87 note 4 ‘Zum Missionscharakter des Johannesevangeliums’, B.F.chr. Th. XLII, 4 (1941).Google Scholar
page 87 note 5 ‘The Origin of the Fourth Gospel’, J.B.L. LXIX (1960), 305 ff.Google Scholar
page 87 note 6 R.N.T. iv (3 1961)Google Scholar; vgl. Ders, auch., Einl. in das N.T. (4 1961), S. 200 ff.Google Scholar
page 87 note 7 Vgl. auch Schnackenburg, R., Neutestamentliche Theologie. Der Stand der Forschung (Bibl. Handbibliothek, Band I; München, 1963), S. 107 ff.Google Scholar
page 87 note 8 Zur phantastischen These Guilding, von A., The Fourth Gospel and Jewish Worship (1960)Google Scholar (Joh.= Wiedergabe der ursprünglich im liturgischen Zusammenhang des jüd. Kirchenjahres gehaltenen Predigten Jesu als Beweis für die Erfallung des jüd. Gottesdienstes in Jesus, gerichtet an kürzlich aus der Synagoge ausgetretene Judenchristen) vgl. Haenchen, E., Th.L.Z. LXXXVII (1962), 487 ff.Google Scholar; Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 158 f.Google Scholar
page 87 note 9 ‘The Purpose of St John's Gospel’, T.U. LXXIII (1959), 382–411.Google Scholar
page 87 note 10 Die Eschatologie des Johannesevangeliums (Assen, 1962)Google Scholar. H. erklärt den ganzen eschatologischen Entwurf des Joh. aus dessen Zielsetzung, Diasporajuden zu gewinnen: ‘Die Juden glauben nicht, daß Jesus der Messias ist, und eben deshalb haben sie diejenigen, die sich zu Jesus bekennen, aus der Synagoge ausgeschlossen. Wer einem Gotteslästerer nachfolgt, kann das ewige Leben nicht erhalten. Demgegenüber sagt das Joh.-Ev.: es ist gerade umgekehrt. Wer glaubt, hat jetzt schon das ewige Leben; wer nicht glaubt, hat jetzt schon seinen Richter’ (S. 264) – Eine ganz unwahrscheinliche Hypothese!
page 87 note 11 Vgl. statt vieler zuletzt Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 157 f.Google Scholar
page 88 note 1 Zu dieser ganz anderen Konzeption vgl. bes. Kuhn, K. G., ‘Das Problem der Mission in der Urchristenheit’, E.M.Z. xi (1954), 161–8, bes. 167 f.Google Scholar
page 88 note 2 Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 222Google Scholar. – Vgl. die sehr guten Formulierungen bei L. Goppelt: ‘“Die Juden” sind die Verkehrung des Eigentumsvolkes in das Widerspiel seiner selbst’ (S. 258), und: ‘Die Welt ist gleich den Juden das Widerspiel dessen, was sie sein soil (Joh. i. 3–10)7— (S. 260).
page 88 note 3 Vgl. Wellhausen, J., S. 117, 122Google Scholar; Baum, G., a. a. O. S. 183, 192.Google Scholar
page 88 note 4 Vgl. Howard, W. F., Christianity according to St John (Philadelphia, 2 1943), S. 24Google Scholar; bes. Bultmann, R., Theol. S. 385 ffGoogle Scholar. (‘Die κρισıς der Welt’).
page 88 note 5 Vgl. Windisch, H., Christi. Welt, XLVII (1933), 106Google Scholar; Bultmann, R., Joh.-Kom. S. 357 ff.Google Scholar
page 89 note 1 Vgl. dazu Robinson, J. A. T., a. a. O. S. 122Google Scholar; Sikes, W. W., a. a. O. S. 30Google Scholar; Jocz, J., a. a. O. S. 142Google Scholar; bes. Ed. Schweizer, , a. a. O. S. 260 f.Google Scholar: ‘Glaube und Unglaube sind Möglichkeiten eines jeden. So wird denn auch die Erwählung Israels, die nicht geleugnet wird, eigentlich nur darin sichtbar, daß sein Unglaube der typische, die Ablehnung κατ' έξοχήν ist.’ Vgl. auch Oepke, A., a. a. O. S. 239.Google Scholar
page 89 note 2 Vgl. Bultmann, R., Theol. S. 380 ff.Google Scholar
page 89 note 3 Schlatter, Schon A., Die Theologie der Apostel (Stuttgart, 2 1922), S. 209 ffGoogle Scholar. hielt das für falsch. Vgl. ebenso Oepke, A., a. a. O. S. 239Google Scholar; Strathmann, H. (siehe oben S. 75ff.).Google Scholar
page 89 note 4 Vgl. Bultmann, R., Theol. S. 385 ffGoogle Scholar. – Daß es nicht möglich ist, die Zeitgeschichte des Vfs. als alleinigen kerygmatischen Anlaß der Polemik zu bezeichnen, wird vielleicht durch den I. Joh. bestätigt. Auch 1. Joh. beschreibt die Offenbarung als Krisis über die Welt (ii. 15 ff.; ii. 18 ff.; iii. i ff.; iv. 4 ff. u. ö.). Aber der Begriff Ίουδαίος kommt überhaupt nicht vor! Hat der 1. Joh. einen andern Vf. und ist er unter ganz andern Umständen geschrieben, so ist das nicht weiter auffällig. Nimmt man aber an, daß der Vf. des vierten Evangeliums und der des 1. Joh. identisch sind und daß beide Schriftstücke nach Zeit und Ort nicht weit auseinanderliegen, so fragt man sich – zumal bei der sachlich gleichartigen Thematik der beiden Schreiben – wo im 1. Joh. das aktuelle Motiv geblieben ist, das für die Gestaltung des vierten Evangeliums angeblich so ausschlaggebend war. Die Frage entfällt, wenn man sieht, daß im Joh.-Ev. die Darstellung des Kampfes der Offenbarung mit der ‘Welt’ in Form eines Lebens Jesu natärlicherweise und primär die ‘Juden’ als Gegner bedingt (vgl. Bultmann, R., R.G.C. 3 III, 845Google Scholar) und nicht etwa eine aktuelle oder gar prinzipielle Judenfeindschaft. Man wird also beides zu berücksichtigen haben: Ihre Schärfe hat die Polemik im Joh.-Ev. erhalten ‘durch die tätliche Feindschaft zwischen Juden und Christen zur Zeit der Abfassung des Joh.’, wie xvi. 2 f. (‘sie werden euch aus den Synagogen ausschließen’) in der Tat beweist. ‘So ist die Polemik gegen das Judentum gewiß ein aktuelles Motiv des Joh., zugleich aber ist diese Polemik hineingenommen in die grundsätzliche dualistische Darstellung des Gegensatzes zwischen dem ![]() ρχων του κόσμου τουτου und dem Christus, der den κόσμος besiegt hat, xii. 31; xvi. 33’ (Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 159).Google Scholar
ρχων του κόσμου τουτου und dem Christus, der den κόσμος besiegt hat, xii. 31; xvi. 33’ (Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 159).Google Scholar
page 89 note 5 Das hat schon klar, W. Baldensperger gesehen, a. a. O. S. 164.Google Scholar
page 89 note 6 Barrett, C. K., ‘Zweck des 4. Evangeliums’, Z.sys.Th. XXII (1953), 257 ffGoogle Scholar. Vgl. auch Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 157.Google Scholar
page 89 note 7 Vgl. Goppelt, L., Die apostol. u. nachapostol. Zeit (Göttingen, 1962), S. 79.Google Scholar
page 90 note 1 Schiatter, A., Theol. der Aposlel, S. 218Google Scholar Der Hebräerbrief versteht sich in gewisser Weise auch als ein Versuch in dieser Richtung. Vgl. dazu demnächst meine Habil.-Schrift ‘Der Glaube im Hebräerbrief’, die in den ‘Marburger Theologischen Studien’ erscheinen soll.
page 90 note 2 Soz. Howard, B. W. F., a. a. o. S. 31Google Scholar; Jocz, J., a. a. o. S. 140Google Scholar; Baum, G., a. a. 0. S. 193Google Scholar: ‘Der Evangelist ist einfach em jüdischer Prophet, der sich in der Qumraner Redeweise ausdrückt und der schäumt vor Wut(!) und Empörung über die Führer der Synagoge, die scm eigenes geliebtes Volk auf so tragische Weise irregeführt haben.’ Dagegen bleibt zu bedenken, daß die oft behauptete Annahme, der Vf. des vierten Evangeliums müsse em gebürtiger Jude gewesen sein, ‘keineswegs eine zwingende’ ist (Feine-Behm-Kümmel, , Einl. S. 172).Google Scholar
page 90 note 3 Schlatter, A., Theol. der Apostel, S. 209 ff.Google Scholar, bes. Goppelt, L., Christentum und Judentum, 254 f., 260.Google Scholar
- 4
- Cited by




