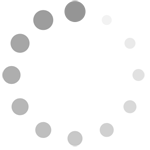Refine search
Actions for selected content:
23990 results in Ancient history
CHAPTER VI - THE ADVANCE OF PERSIA TO THE AEGEAN
-
- Book:
- A History of Greece
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 05 March 2015, pp 219-264
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
CHAPTER IX - THE ATHENIAN EMPIRE UNDER THE GUIDANCE OF PERICLES
-
- Book:
- A History of Greece
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 05 March 2015, pp 346-389
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
ILLUSTRATIONS
-
- Book:
- A History of Greece
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 05 March 2015, pp xvii-xxiv
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
Frontmatter
-
- Book:
- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 14 February 2013, pp i-i
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
CHAPTER LXXI
-
- Book:
- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 14 February 2013, pp 301-326
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
CHAPTER LXVIII
-
- Book:
- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 14 February 2013, pp 159-208
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
CHAPTER LXVII
-
- Book:
- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 14 February 2013, pp 132-158
- First published in:
- 1900
-
- Chapter
- Export citation
VII - Zur Rechtfertigung des zweiten Bandes meiner Geschichte des Alterthums
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 512-548
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
III - Wehrkraft, Bevölkerungszahl und Bodencultur Attikas
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 149-195
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
II - Zur Geschichte der attischen Finanzen im fünften Jahrhundert
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 88-148
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
I - Die Biographie Kimons
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 1-87
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
Index
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 549-554
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
Frontmatter
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp i-iv
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
IV - Herodots Geschichtswerk
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 196-268
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
Inhalt
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp vii-viii
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
V - Thukydides
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 269-436
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
VI - Chronologische Untersuchungen. Die Regierungszeiten der persischen und der spartanischen Könige
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp 437-511
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
Vorwort
-
- Book:
- Forschungen zur Alten Geschichte
- Published online:
- 03 May 2011
- Print publication:
- 19 August 2010, pp v-vi
- First published in:
- 1899
-
- Chapter
- Export citation
Frontmatter
-
- Book:
- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 14 February 2013, pp i-ii
- First published in:
- 1898
-
- Chapter
- Export citation
CHAPTER XXXVIII
-
- Book:
- The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
- Published online:
- 05 June 2015
- Print publication:
- 14 February 2013, pp 98-169
- First published in:
- 1898
-
- Chapter
- Export citation