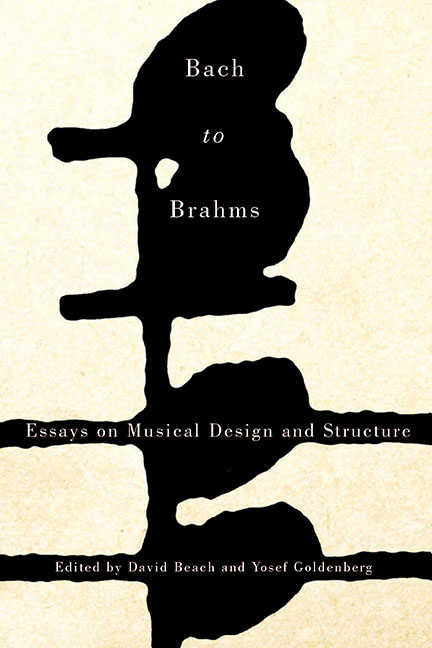Es gibt das Vorurteil, die Liebe des “armen B.B.” zur Dialektik sei unglücklich gewesen, weil unerwidert geblieben. Brecht selbst jedenfalls hätte ein Liebesverhältnis wohl gar nicht erst für sich beansprucht: So wie Marx im Vorwort des Kapital gab sich auch Brecht nüchtern als Schüler Hegels und seiner Dialektik zu erkennen. Ohnehin gefiel Brecht das Lehrer-Schüler- Verhältnis; es entsprach seinem emphatischen Begriff einer Praxis, die “eingreifendem Denken” verpflichtet ist und keine Angst vor Erziehung hat. Er akzeptierte Hegel als Lehrer und sogar “Meister” allein schon darum, weil er, Hegel, es ja gewesen war, der in seiner Phänomenologie des Geistes den Herrn als Knecht des Knechts vorstellte, und für Brecht ist, wie wir spätestens seit dem Leben des Galilei wissen, der Lehrer von den Fragen des Schülers abhängig. Oder vielmehr ist es das Wissen des Lehrers, das davon abhängig ist.
Die Aufgabe, das Verhältnis von Brecht zu Hegel zu bestimmen, hat Frank D. Wagner in Hegel und Brecht. Zur Dialektik der Freiheit sich gestellt. Trotz gelegentlich weitschweifiger Ausführungen des 516 Seiten starken Buches werden Status und Stellung der Dialektik bei Brecht regelmäßig zuverlässig auf den Punkt gebracht. Diese Punktgenauigkeit gilt vor allem für die Haltung, die Brecht gegenüber Hegel einnimmt. Wagner stellt sie als ebenso ehrfurchtsvolle wie antiautoritäre Haltung vor, sowohl gegenüber Hegel als auch, was letztlich auf dasselbe hinausläuft, gegenüber Hegels Version der Dialektik, die Brecht als “die Große Me thode” bezeichnet. Diese Haltung gilt auch gegenüber Hegels Texten, die Brecht, bei aller Bewunderung, Wagner zufolge durchgehend pragmatisch und selektiv gebraucht—jedoch stets, um mit Hegel das zu treffen, was alle angeht: “seine Lektüre ist ein Verstehen-wollen und Kritik-Üben, also ein produktives Verfahren” (S. 218). Und wo Hegel hermetisch, übermächtig oder gebieterisch wirkt, ist für Brecht, so wie das auch für seine Figuren gegenüber der Macht kennzeichnend ist, der listige, ironische Umgang befreiend und entlastend.
Zum pragmatisch-selektiven Gebrauch von Hegel passt, dass Brecht weder, wie etwa Benjamin, vom Hegel-Gegner zum Befürworter wurde, noch war die Hegel-Lektüre nur eine kurze intensive Phase der Versenkung wie bei Lenin, noch war sie eine Art Erweckung und brachte eine Wendung, wie das dem jungen Lukács mit Marx widerfuhr. Hegel war vielmehr ein ständiger Begleiter, und letztlich hat Brecht wohl schlicht, wie Wagner feststellt, bei Hegel immer wieder nach “Vorlagen gesucht für eigene Produktion” (S. 108).